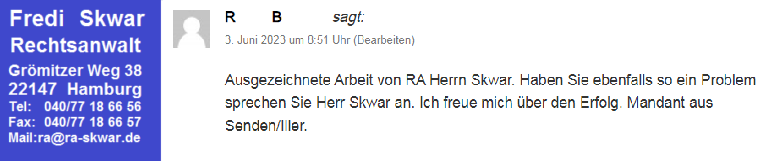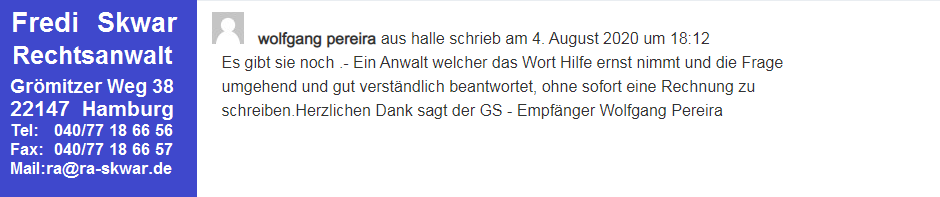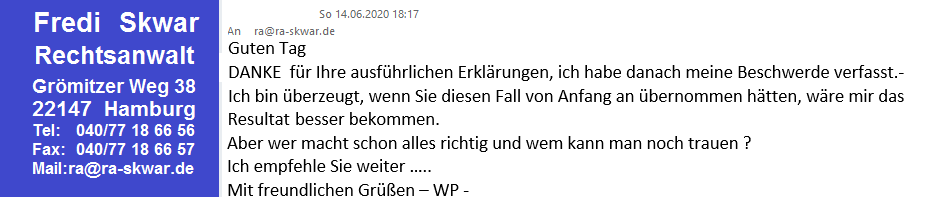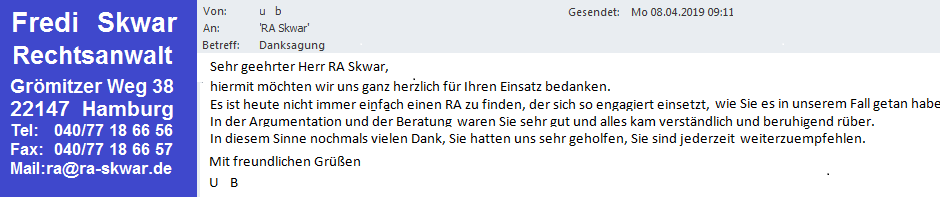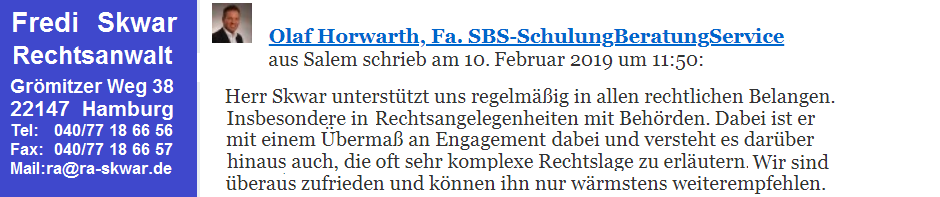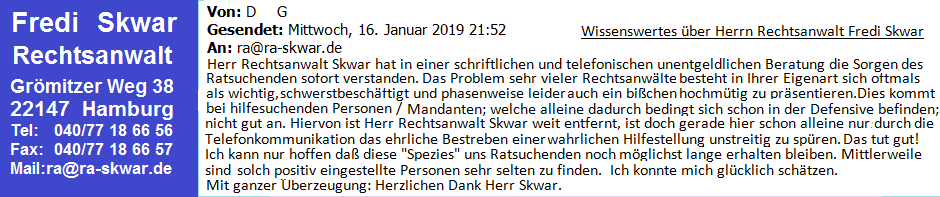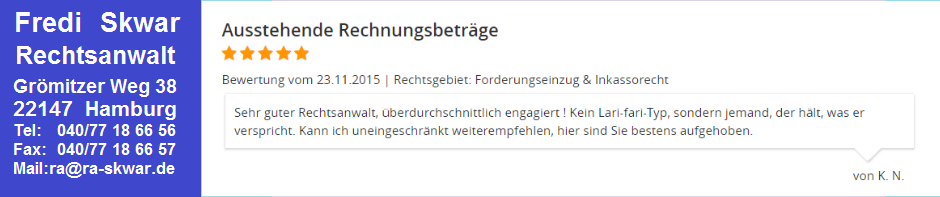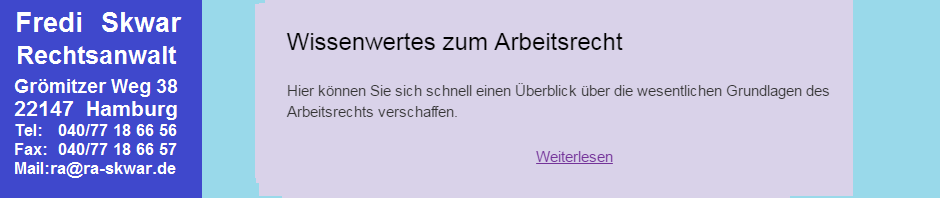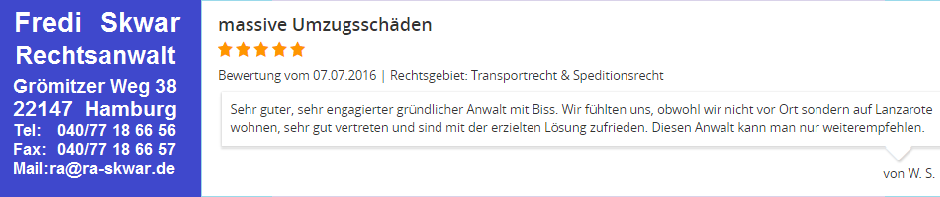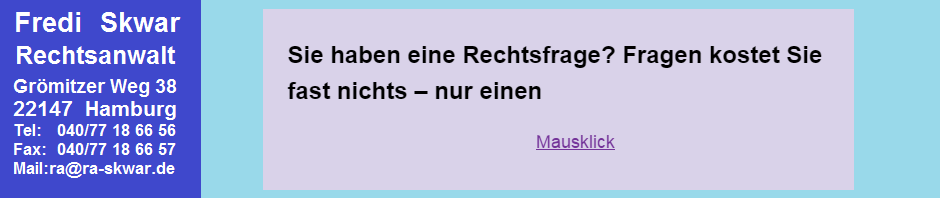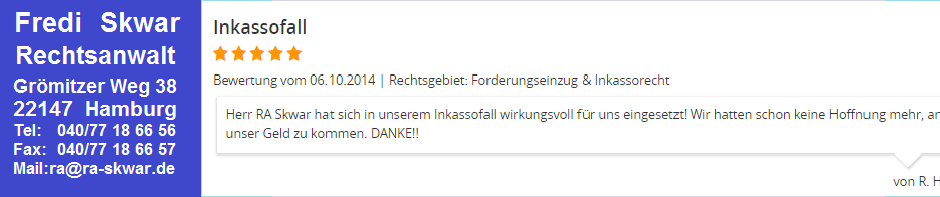OLG Köln, Urteil vom 12.08.2009 – 5 U 47/09, I-5 U 47/09 – LASIK-Behandlung
1. Eine Laser-Operation am Auge zur Beseitigung einer normalen Kurzsichtigkeit, die ohne weiteres auch durch das Tragen von Kontaktlinsen oder einer Brille zu korrigieren ist, und für die eine weitergehende medizinische Indikation nicht besteht, ist einer kosmetischen Operation im Hinblick auf die Anforderungen an die Aufklärung vergleichbar. Dies gilt insbesondere im Hinblick auf das Tauschrisiko, das bei Auftreten von Komplikationen im Verlust des Augenlichts bestehen kann, und ganz besonders, wenn das andere (nicht operierte) Auge nahezu erblindet ist (Rn.2).
2. Bei einem Patienten in vorgerücktem Alter ist auch darüber aufzuklären, dass der dauerhafte Erfolg einer Laser-Operation fraglich ist(Rn.2).
3. Verliert eine 65-jährige Patientin, die zuvor auf dem rechten Auge praktisch erblindet war und auf dem linken Auge über eine Sehschärfe von 0,8 p verfügte, durch eine rechtswidrige Operation ihr Augenlicht soweit, dass sie nunmehr nur noch über eine Sehschärfe von 0,2 p verfügt, ist ein Schmerzensgeld von 40.000 € jedenfalls nicht zu hoch (Rn.9).
(Leitsatz des Gerichts)
Tenor
Die Parteien werden darauf hingewiesen, dass der Senat nach Beratung erwägt, die Berufung durch einstimmigen Beschluss gemäß § 522 Abs. 2 ZPO zurückzuweisen, weil sie keine Aussicht auf Erfolg hat (§ 522 Abs. 2 Nr. 1 ZPO) und auch die weiteren Voraussetzungen gemäß § 522 Abs. 2 Nr. 2, 3 ZPO vorliegen.
Gründe
I.
1
Die Berufung hat keine Aussicht auf Erfolg. Das angefochtene Urteil erweist sich auch unter Berücksichtigung des Berufungsvorbringens als richtig. Die Klageabweisung beruht weder auf einer Rechtsverletzung noch rechtfertigen nach § 529 ZPO zugrundezulegende Tatsachen eine andere Entscheidung (§ 513 Abs. 1 ZPO).
2
Zu Recht und mit zutreffender Begründung, die sich der Senat in jedem Punkt zu Eigen macht, hat die Kammer Schmerzensgeld- und Schadensersatzansprüche (diese dem Grunde nach) der Klägerin wegen unzureichender Aufklärung bejaht. Eine Aufklärung zur Patientenselbstbestimmung muss grundsätzlich so erfolgen, dass dem Patienten Tragweite und Konsequenzen des beabsichtigten Eingriffs vollständig klar sind; er soll Art und Schwere des Eingriffs erkennen und richtig einordnen können (vgl. nur beispielhaft BGH VersR 1990, 808). Bei einem allenfalls relativ indizierten Eingriff muss der Arzt sorgfältig das Bedürfnis des Patienten, den Eingriff durchführen zu lassen, den damit verbundenen Vorteil der Behandlung in Relation zu dem damit eingetauschten Risiko ermitteln und mit dem Patienten besprechen. Insbesondere ist klar und deutlich anzusprechen der Stellenwert des eingetauschten Risikos gegenüber den Folgen einer Nichtbehandlung (vgl. hierzu etwa BGH VersR 1980, 1145; BGH NJW 1981, 1319). Dies gilt etwa für den Fall der rein kosmetischen Operationen, aber auch für andere Fälle hoher Risiken bei zweifelhafter Operationsindikation. Um einen damit vergleichbaren Fall handelt es sich vorliegend. Eine Laser-Operation am Auge zur Beseitigung einer normalen Kurzsichtigkeit, die ohne weiteres auch durch das Tragen von Kontaktlinsen oder einer Brille zu korrigieren ist, und für die eine weitergehende medizinische Indikation nicht besteht, ist einer kosmetischen Operation im Hinblick auf die Anforderungen an die Aufklärung grundsätzlich vergleichbar (bezeichnenderweise heißt es selbst im Prospekt der Beklagten, dass es sich bei der LASIK-Behandlung nicht um die Behandlung einer Krankheit handele, und deshalb auch keine Krankschreibung erfolgen könne). Hier ist besonders umfassend aufzuklären (vgl. etwa OLG Düsseldorf VersR 2001, 374 für den Fall einer Augenoperation). Verschlechterungsmöglichkeiten und ein Missverhältnis bei dem Tauschrisiko müssen in aller Deutlichkeit angesprochen werden (BGH VersR 1980, 1145; BGH NJW 1981, 1319; BGH NJW 1992, 2354; BGH NJW 1997, 1637; BGH NJW 1998, 1784). Dies gilt schon für eine Operation, wenn beide Augen noch prinzipiell funktionstüchtig sind. Es gilt um ein Vielfaches, wenn – wie hier – bereits ein Auge weitestgehend erblindet ist und die Operation am anderen Auge durchgeführt werden soll. Hier stehen das Tauschrisiko eines Verlustes des einzig verbliebenen Auges gegen den möglichen Heilerfolg (nämlich künftig weitgehend, nicht einmal ausnahmslos, auf eine Brille verzichten zu können) in einem besonders krassen Missverhältnis. Das muss zwischen Arzt und Patient umfassend thematisiert sein. Es muss sicher gewährleistet sein, dass dem Patienten die Risiken in aller Konsequenz vor Augen stehen und er sich in vollem Bewusstsein des Tauschrisikos auf den Eingriff einlässt. Dem Sicherheitsbedürfnis des Patienten muss ebenso sorgfältig Rechnung getragen werden wie der Frage des für den Patienten resultierenden Wertes der Behandlung. Hier hätte demnach konkret angesprochen werden müssen, dass selbst dann, wenn nach aktuellem Befund keine besonderen Anhaltspunkte für eine besondere Gefährdung vorliegen, immer Komplikationen auftreten können, die dann zum endgültigen oder weitgehenden Verlust des Augenlichtes führen könnten. Es hätte deutlich angesprochen und diskutiert werden müssen, dass schon angesichts des vorgerückten Alters der Patientin Erkrankungen auftreten könnten, die andersartige Operationen nach sich ziehen könnten, und die ein Abwarten oder einen Verzicht auf die LASIK-Operation sinnvoll machen könnten. Damit ist nicht nur der Aspekt der alternativen Behandlungsmöglichkeit angesprochen (konservativ statt operativ), über die stets aufzuklären ist, sondern auch und erst recht der Aspekt eines sehr fraglichen dauerhaften Erfolges des operativen Eingriffs.
3
Diesen Anforderungen wird die der Klägerin erteilte Aufklärung schon nach dem eigenen Vorbringen der Beklagten bei weitem nicht gerecht. Im Rahmen seiner persönlichen Anhörung hat der Beklagte zu 1) in wesentlichen ausgeführt, dass der Klägerin – wie üblicherweise jedem Patienten – die Broschüre der Praxis vorab zur Kenntnis gegeben worden sei, dass in einem ersten Gespräch ausführlich über das Ziel der Behandlung und über die Vorteile der LASIK-Operation gegenüber anderen möglichen Operationen (insbesondere Linsenoperation) gesprochen worden sei, dass in einem “formalen” Aufklärungsgespräch einige Stunden vor der eigentlichen Operation darüber gesprochen wurde, als Folgen des Eingriffs etwa 6 Monate lang könnten ein trockenes Auge oder Entzündungen oder Wundheilungsstörungen auftreten und eventuell eine Nachoperation erforderlich werden. Diese Aufklärung, die auch schriftsätzlich nicht eingehender dargestellt wurde, lässt schon eine der Situation angemessene Darstellung der Risiken vermissen. Es war nicht damit getan, “formal” (also routinemäßig) Risiken wie Entzündungen oder Wundheilungsstörungen anzusprechen. Es ging darum, der Klägerin ein klares und plastisches Bild von den möglichen Folgen von Komplikationen zu verschaffen, ihr klipp und klar zu sagen, dass sie, wenn sie Pech hatte, das Augenlicht ganz einbüßen konnte. Da es sich um einen alles andere als notwendigen medizinischen Eingriff handelte, bestand auch kein Grund, diese Aufklärung besonders schonend vorzunehmen. Die möglichen Risiken wurden auch nicht hinreichend präzise angesprochen. Unter “Wundheilungsstörungen” und “Entzündungen” kann sich ein medizinischer Laie regelmäßig wenig vorstellen. Vor allem aber fehlt es an einer individuellen, patientenbezogenen (eben nicht nur “formalen”) Aufklärung, die den (geringen) Nutzen des Eingriffs in Relation zu möglichen (schweren) Risiken thematisierte und der Patientin verdeutlichte, wie hoch das Tauschrisiko war. Dass der Klägerin zuvor die Broschüre der Beklagten (die sich im übrigen nur am Rande mit etwaigen Komplikationen befasst und keinerlei individuellen Einschlag hat) vorlag, und dass sie ein Einverständnisformular unterschrieb, in dem eine Reihe von möglichen Komplikationen aufgeführt war (die ihrerseits die schwerste denkbare Folge ebenfalls nicht hinreichend deutlich werden ließen), ist ohne Bedeutung, denn maßgeblich ist allein das, was Gegenstand des Aufklärungsgesprächs war.
4
Soweit die Beklagten mit der Berufung geltend machen, es komme entscheidend darauf an, dass sich im Rahmen der ordnungsgemäßen Voruntersuchungen keine Kontraindikationen für die Operation ergeben hätten, und dass es insbesondere keinerlei Hinweise auf die möglicherweise vorliegende asymptomatische Map-Dot-Finger-Dystrophie gegeben habe, liegt ihre Argumentation neben der Sache und ist ungeeignet, einen Aufklärungsmangel entfallen zu lassen. Hätten sich solche Hinweise ergeben, hätte definitiv eine Kontraindikation vorgelegen und den Beklagten wäre ein Behandlungsfehler vorzuwerfen. Tatsache war, dass die Beklagten das Risiko einer solchen Grunderkrankung nicht sicher ausschließen konnten, und dass deshalb auf derartige potentielle Risiken hinzuweisen war.
5
Nicht mit Erfolg können sich die Beklagten darauf berufen, dass der Klägerin ihre “Einäugigkeit” bekannt gewesen sei und sie im Hinblick auf die daraus resultierenden besonderen Risiken nicht aufklärungsbedürftig gewesen sei, so dass sie die Folgen ihrer Entscheidung selbst zu tragen habe. Es ging gerade nicht um das (abstrakte) Wissen, dass sie bei Verlust dieses einen Auges ihre gesamte Sehfähigkeit verlieren würde, sondern um die Gefährlichkeit dieses konkreten Eingriffs in Relation zu dem
6
geringen persönlichen Nutzen. Dass die Klägerin diese Risikosituation verlässlich einschätzen konnte und deshalb keiner weiteren Aufklärung bedurft habe, behaupten die insoweit darlegungs- und beweisbelasteten Beklagten selbst nicht.
7
Für eine hypothetische Einwilligung der Klägerin, für die die Beklagten ebenfalls darlegungs- und beweispflichtig sind (BGHZ 90, 103 ff.), fehlt es schon an einer hinreichenden, nachvollziehbaren Darlegung. Dass die Klägerin in jedem Fall in den Eingriff eingewilligt hätte, lässt sich auch keinesfalls aus den zitierten Äußerungen der Klägerin und des Zeugen I. entnehmen. Dass die Klägerin letztlich zu der Operation entschlossen war, besagt nichts darüber, ob sie ungeachtet einer deutlichen Aufklärung über die Gefahren an diesem Entschluss festgehalten hätte. Ebenso wenig besagt die Äußerung des Zeugen, dass das weitere Tragen der Brille “keine Alternative” gewesen sei. Diese Äußerung war ersichtlich nicht in dem Sinne gemeint, dass die Klägerin bereit gewesen sei, jedes Risiko in Kauf zu nehmen, wenn sie nur ihre Brille (die sie seit mehreren Jahrzehnten ohne Beschwerden trug) nicht mehr tragen müsse. Sie war vielmehr in dem geschilderten Kontext zu sehen, dass sie von den Möglichkeiten einer solchen Operation sehr angetan gewesen sei und sich nach einem Gespräch, das sie von der vermeintlichen Harmlosigkeit der Operation überzeugt habe, endgültig zu dieser entschlossen habe. Mit hypothetischer Einwilligung hat das nichts zu tun. Im Rahmen ihrer persönlichen Anhörung vom 4.6.2008 hat die Klägerin denn auch unmissverständlich und nachvollziehbar zum Ausdruck gebracht, dass sie habe absolut sicher sein wollen, dass ihrem einzigen gesunden Auge nichts passieren könne.
8
Die Kausalität zwischen dem mangels wirksamer Einwilligung rechtswidrigen Eingriff und dem eingetretenen Gesundheitsschaden, der letztlich im Verlust der Sehstärke des linken Auges von 0,8 auf 0,2 liegt, ist gegeben. Dass der operative Eingriff vom 8.8.2006 der Auslöser eines Prozesses war, der über wiederkehrende “Erosiones” der Hornhaut in Verbindung mit der in der Folge diagnostizierten Map-Dot-Finger-Dystrophie zum angegebenen Verlust der Sehfähigkeit führte, wird letztlich auch von den Beklagten nicht bestritten, ergibt sich aber jedenfalls mit aller Eindeutigkeit aus den vorliegenden medizinischen Behandlungsunterlagen und Gutachten (recht anschaulich im Gutachten des Medizinischen Dienstes der Krankenversicherung O. beschrieben: “Ab diesem Zeitpunkt setzt eine unvermeidbare Dynamik ein, deren Ursache eine … nicht erkannte chronische Erkrankung der Hornhaut ist…”). Dass dabei die festgestellte Dystrophie eine maßgebliche Bedeutung für die Krankheitsentwicklung erlangt hat, ist für die Frage der Kausalität ohne Bedeutung. An der Kausalität ändert sich nichts dadurch, dass ein Schädiger auf einen zum (besonderen) Schaden neigende Person trifft. Anders wäre es nur, wenn die chronische Erkrankung der Klägerin unweigerlich und ohne jeden Bezug zum erfolgten Eingriff durch die Beklagten zum gleichen Schaden geführt hätte, wenn also die Operation weggedacht werden könnte, ohne dass sich am Schadensverlauf etwas ändern würde. Das Vorliegen eines derartigen hypothetischen Kausalverlaufs behaupten die Beklagten aber selbst nicht und hierfür gibt es auch in den medizinischen Stellungnahmen keinerlei Anhaltspunkt.
9
Die Höhe des zuerkannten Schmerzensgeldes ist nicht zu beanstanden. Das ihnen eingeräumte Ermessen haben die Richter der 25. Zivilkammer sachgerecht und jedenfalls nicht zu Ungunsten der Beklagten ausgeübt. Maßgeblich für die Bemessung ist das Ausmaß der Beeinträchtigungen, insbesondere derjenigen, die für die weitere Lebensführung auf Dauer wirken. Eindeutig im Vordergrund steht damit der weitgehende Verlust der Sehkraft, der auf eine Restsehfähigkeit von nunmehr noch 0,2 auf dem linken Auge reduziert ist. Für einen Menschen, der zuvor mit der noch vorhandenen Sehkraft eines Auges von 0,8 bei entsprechender Korrektur durch eine Brille gut zurecht kam, ist dieser Verlust denkbar einschneidend und gravierend. Zu vergleichen sind derartige Fälle also nicht etwa mit Entscheidungen, bei denen der Geschädigte ein Auge (fast) verloren hat, sondern mit solchen, bei denen die Folgen im weitgehenden Verlust des gesamten Augenlichtes liegen. Für den Verlust eines Auges wurde schon in den neunziger Jahren des letzten Jahrhunderts ein Schmerzensgeld ausgewiesen, das die hier streitige Summe von 40.000.- € in etwa erreichte (vgl. die zahlreichen Nachweise bei Jaeger/Luckey Stichwort “Auge”), für vollständige Erblindung liegen die Summen ohne weiteres im sechsstelligen Bereich. Die zuerkannte Summe kann damit als eher am unteren Rand des Ermessensrahmens angesehen werden und rechtfertigt sich letztlich nur damit, dass der Klägerin eben tatsächlich noch eine nicht ganz unerhebliche Sehfähigkeit verblieben ist. Dies gilt auch unter Berücksichtigung der Tatsache, dass die Klägerin mit (zum Schadenszeitpunkt) 65 Jahren nicht mehr ganz jung ist (die meisten Vergleichsentscheidungen betreffen deutlich jüngere Geschädigte), andererseits aber ein aktiver und ihr Leben selbst gestaltender, im Wesentlichen unbeeinträchtigt lebender Mensch war. Die von ihr gegenüber dem Gutachter geschilderten Folgen des weitgehenden Verlustes ihrer Sehfähigkeit, nämlich dass sie nun nicht einmal mehr in der Lage sei, ihren Haushalt zu führen, ihre Einkäufe zu tätigen und umfassend auf die Hilfe anderer angewiesen sei, ist für den Senat unmittelbar glaubhaft. Sonstige Beeinträchtigungen, wie etwa häufig schmerzende und tränende Augen, treten gegenüber dem Verlust der Sehfähigkeit bereits deutlich in den Hintergrund. Erst recht kommt es nicht auf die Frage an, ob weitergehende vorübergehende Komplikationen oder Erkrankungen (etwa die Herpeserkrankung) oder Unfälle (etwa der Sturz im Februar 2007) nachweislich Folge der Behandlung durch die Beklagten sind oder nicht. Auf die Angemessenheit des zuerkannten Schmerzensgeldes hat dies keinen Einfluss.
10
Der immaterielle Vorbehalt ist zu Recht ausgesprochen worden. Es genügt, dass heute noch nicht vorhersehbare weitere Schäden an der Gesundheit denkbar sind. Dies ist schon aufgrund der nicht fern liegenden Gefahr, weitere Unfälle zu erleiden, die auf die verminderte Sehfähigkeit zurückzuführen sind, der Fall. Gleiches gilt für die Möglichkeit von heute noch nicht abschätzbaren Folgeeingriffen.
11
Der Feststellungsantrag bezüglich materieller Schäden ist ebenfalls begründet. Dass der Klägerin mit einiger Wahrscheinlichkeit für die Zukunft materielle Schäden entstehen und für die Vergangenheit entstanden sein können (mehr besagt der Tenor nicht), ist nicht zweifelhaft. Inwieweit die bislang geltend konkret gemachten materiellen Schäden begründet sind, ist im Höheverfahren, das noch vor dem Landgericht anhängig ist, zu entscheiden. Gleiches gilt für die Frage, ob und inwieweit der Klägerin ein Haushaltsführungsschaden oder schadensbedingte Mehraufwendungen entstanden sind.
II.
12
Die Beklagten haben Gelegenheit zur Stellungnahme binnen drei Wochen (§ 522 Abs. 2 Satz 2 ZPO).